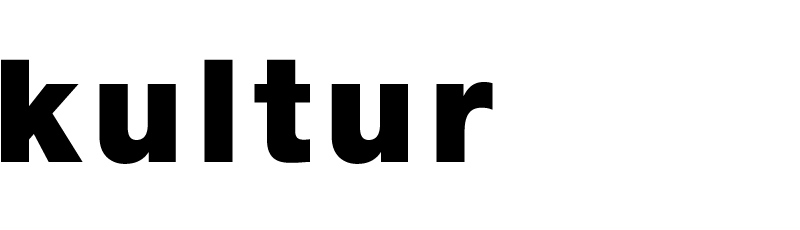Eine der ältesten erhaltenen Bibliotheken der Menschheit wurde im heutigen Irak gefunden. Sie weist Parallelen zur Gegenwart auf. So haben die Tontafeln, auf denen hier Friedensverträge und Eigentumsverhältnisse aufgeschrieben wurden, vom Formfaktor her Ähnlichkeiten mit Smartphones und liegen teilweise wohl sogar noch besser in der Hand. Ausserdem fanden sich überall Spuren mutwilliger Zerstörung.
Die Krux der geretteten Archive
Seitdem es sie gibt, sind Bibliotheken und Archive Ziele von Zerstörungsorgien. Wer sich Zutritt zu den Archiven seines Gegners verschafft, kann dessen Gedächtnis zerstören und verstümmeln. Ein besonders scheussliches Kapitel in dieser Geschichte: «Die Verfolgung der Juden Europas durch das nationalsozialistische Regime richtete sich nicht nur mit entsetzlicher Gewalt gegen das Volk des Buchs (wie Juden sich seit Jahrtausenden bezeichnen), sondern auch gegen seine Bücher.» 100 Millionen Bücher des jüdischen Kulturkreises, so die Schätzung von Autor Richard Ovenden, seien vernichtet worden. Zum Glück schafften es jüdische Widerstandsgruppen, beispielsweise in Litauen und Polen, wenigstens einige Bücher zu retten.
Ovenden berichtet auch vom Papiergebirge, das Saddam Husseins Baath-Partei hinterliess: 5,5 Millionen Dokumente während 35 Jahren Herrschaft. Dieses Archiv befindet sich heute auf Betreiben von Exilirakern in den USA. Zuvor hatte es im Irak mehrere Angriffe von Regimeschergen auf das Archiv gegeben. Die Krux: Wohl kann das Archiv in den USA gesichert und digitalisiert werden – doch dem Irak fehlt ein Teil seines Gedächtnisses, das nötig wäre für die Aussöhnung und Aufarbeitung der Vergangenheit.
Weitere Stationen sind die 1914 und 1940 von deutschen Invasoren zerstörte Bibliothek von Löwen in Belgien oder die in den 1990ern verwüstete Universitätsbibliothek von Sarajewo. Sie wurde von serbischen Belagerern in Brand geschossen – bevor Heckenschützen und Flugabwehrkanonen die Feuerwehr beschossen. Nach dem Krieg wurden die Verantwortlichen in Den Haag vors Kriegsverbrechertribunal gestellt. «Der Internationale Strafgerichtshof betrat Neuland, als er Kriegsverbrechen gegen Kulturerbe, vor allem gegen ethnisch und religiös bedeutsame Gebäude, Bibliotheken und Archive erfolgreich strafrechtlich verfolgte», schreibt Ovenden.
«Bedrohte Bücher», als «Wissenschaftsbuch des Jahres 2022» nominiert, ist ein fesselnder Einblick in 3000 Jahre Bibliothek- und Archivgeschichte – und ein regelrechter Pageturner. Ausführliche Anmerkungen, Literaturhinweise und Register laden zu Recherchen ein. Zuweilen bleibt das Buch etwas an der Oberfläche, etwa bei den irakischen Archiven in den USA. Es findet sich kein Wort darüber, dass nicht nur die Sorge um den Erhalt des Archivs, sondern auch die Reinigung des Archivs von unliebsamen Dokumenten von Bush sen. bis Saddam Hussein für den Abtransport ausschlaggebend gewesen sein dürfte. Aber das ist lässlich angesichts von 416 Seiten leidenschaftlichen Plädoyers für Bibliotheken und Archive.
Buch
Richard Ovenden
Bedrohte Bücher – Eine Geschichte der Zerstörung und Bewahrung des
Wissens; 416 S.
(Suhrkamp 2021)