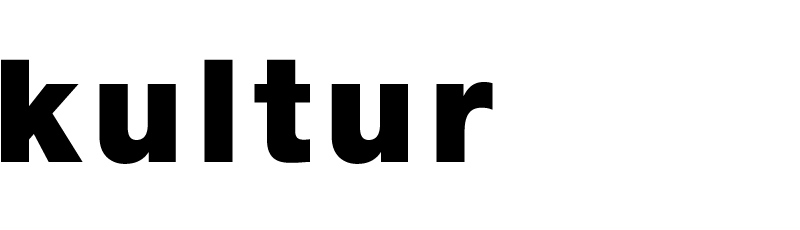Ihr Leben hat sich die junge Ich-Erzählerin Wanda ganz anders vorgestellt: Statt dass sie als Schauspielerin durchstartet und glamouröse Partys feiert, lebt sie mit ihrer fünfjährigen Tochter Karlie in Berlin-Lichtenberg in einer schäbigen Wohnung in einem Hochhaus im 18. Stock. Hier wartet sie auf Rollenangebote und stellt fest: «Ich wollte nie so werden, wie die anderen hier. Ich wollte nie eine von ihnen sein, mit platt gedrückten Haaren vom vielen Fernsehen.»
Wer schafft den Absprung?
Und doch tut sie sich mit den anderen Müttern im Block zusammen: mit Aylins Mama, deren Tochter mit Karlie befreundet ist und die Wanda stets unverblümt ihre Meinung geigt: etwa dass der Zug doch abgefahren und Schauspielerin eh kein richtiger Beruf sei. Oder mit Ming, die mit ihren Zwillingen und ihrem lieblosen Mann ausgepowert ist. Oder mit Esther, die schuftet und schuftet und doch auf keinen grünen Zweig kommt. Sie alle leben in der Berliner «Platte», streiten sich, reden auch mal schlecht übereinander, feiern aber auch Feste zusammen und helfen sich, wenn es darauf ankommt.
Doch dann kommt tatsächlich Wandas Chance auf eine grössere Rolle, die sie in die Glamourwelt bringen könnte. «Glück lässt sich von Pisse im Treppenhaus nicht abschrecken, Glück findet von Zeit zu Zeit sogar in den 18. Stock», frohlockt sie, während «die Motoren auf der Frankfurter bollern und knallen wie Champagnerkorken». So lässt Sara Gmuer in ihrem zweiten Roman Plattenbau-Tristesse auf die Welt der Schönen und Reichen prallen. Eine Zeit lang scheint es, als ob sich das Blatt für Wanda tatsächlich wenden könnte. Sie diniert in luxuriösen Berliner Restaurants, lernt einflussreiche Produzenten kennen, verstrickt sich gar in eine Liebesgeschichte mit dem Schauspielstar Adam.
Im Berliner Strassenslang
Aber so einfach ist es nicht, diese beiden Universen zusammenzubringen, besonders wenn man eine kleine Tochter hat, die schwer erkrankt.«Keiner braucht ’ne Mutti, die nach Hause rennt, sobald das Kind schreit», macht ihr Agent klar. Mutterschaft und Karriere unter einen Hut zu bringen, wie man so schön sagt, ist besonders als Alleinerziehende nach wie vor nicht einfach. Und Wanda fragt sich sarkastisch: «Was soll das für ein Hut sein, ein Zauberhut, ein schwarzer Zylinder mit Kind, Karriere und Kaninchen drin, oder was?»
Die 44-jährige Schriftstellerin Sara Gmuer, die in einem Tessiner Dorf aufgewachsen ist und seit vielen Jahren in Berlin lebt, hat sich nach ihrem Debüt «Karizma» für ihren zweiten Roman zwölf Jahre Zeit genommen. Als ehemalige Rapperin, als Schauspielerin, Model und Mutter kennt sie die unterschiedlichen Szenen und schreibt authentisch und im Berliner Strassenslang über Glamour und «Platte» gleichermassen. So ist mit «Achtzehnter Stock» ein Roman entstanden, der mit seinen vielschichtigen Figuren, deren Träumen und Ängsten, Niederlagen und Höhepunkten berührt und packt.
Lesung
Di, 8.4., 20.00 Kaufleuten Zürich
Buch
Sara Gmuer
Achtzehnter Stock
224 Seiten
(Hanserblau 2025)
Erhältlich ab Di, 18.2.
5 Fragen an Autorin Sara Gmuer
«Ich habe durch Rap ein Gefühl für die Sprache bekommen»
kulturtipp: «Rap war mein Trainingscamp, mein tägliches Workout im Umgang mit Sprache», schreiben Sie auf Ihrer Homepage. Wie haben Sie durch Rap zur Literatur gefunden?
Sara Gmuer: Ich habe durch Rap ein Gefühl für Sprache bekommen, war aber immer abhängig von anderen. Ich brauchte Beats, Studios, Produzenten. Irgendwann wollte ich etwas machen, bei dem ich nur auf mich selbst gestellt bin. Wo ich niemandem die Schuld geben kann, wenn es nicht klappt. Also habe ich angefangen, einen Roman zu schreiben. Mein Stil hat sich im Vergleich zu meinem Debüt weiterentwickelt. Ich wollte mich auf keinen Fall wiederholen. Der Sound ist geblieben, nicht mehr ganz so laut, dafür ausgefeilter.
Sie siedeln Ihren Roman zwischen trister Hochhaussiedlung und luxuriöser Filmwelt in Berlin an. Kennen Sie als Schauspielerin und Model selbst diese Gegensätze?
Ich kenne die Gegensätze, aber nicht unbedingt vom Modeln oder von der Schauspielerei. Die Jobs waren nicht so glamourös. Ich hatte in meinem Leben mit Leuten zu tun, die auf unterschiedliche Weise zu Ruhm und Reichtum gekommen sind. Mich hat das schon immer fasziniert, ich fühlte mich aber eher den Underdogs zugehörig. Ich stand irgendwo zwischen diesen Welten, nah genug, um sie zu verstehen, aber nie ganz Teil davon.
Ihre Ich-Erzählerin Wanda will anders sein als die anderen Mütter im Plattenbau. Wie hat sich die Hauptfigur herauskristallisiert?
Ich wusste, dass ich eine Figur erzählen will, die an ihren Träumen festhält, egal, wie oft sie scheitert. Sie sollte nicht nur gegen äussere Hürden kämpfen, sondern auch gegen ihre eigenen Zweifel und die Stimmen um sie herum, die ihr einreden, sie solle sich mit weniger zufriedengeben. So richtig ist Wanda erst beim Schreiben entstanden. In den Begegnungen mit den anderen Figuren musste ich überlegen, wie sie reagieren würde, und dadurch wurde ihr Charakter nach und nach klarer.
Welche Szene stand am Anfang Ihres Romans?
Die allererste Szene, die ich geschrieben habe, war eine, die in der Berliner Bar Bellman spielt. Ich hatte sofort die safrangelben Polster und die Kronleuchter vor Augen. Und dann war auch schnell klar, dass ich als Kontrast die «Platte» brauche. Aber wirklich angefangen, am Roman zu arbeiten, habe ich erst, nachdem meine Tochter an einer bakteriellen Hirnhautentzündung erkrankt war. Ich musste das Erlebte irgendwie verarbeiten, und ich hatte das Gefühl, dass die Geschichte dadurch eine Tiefe bekommt, die sie sonst nicht gehabt hätte.
Ein wichtiges Thema im Buch ist auch die Vereinbarkeit von Beruf und Mutterschaft. Wie nehmen Sie diese Diskussion als Autorin und Mutter zweier Kinder wahr?
Das Thema ist universell, und doch gibt es nicht die eine richtige Lösung. Jede Familie funktioniert anders, jede Mutter hat andere Bedürfnisse. Ich finde, wir sollten weniger in Klischees denken. Kinder grosszuziehen, ist ein Ausnahmezustand, und ich kann oft selbst nicht sagen, was ich gerade bin – Hausfrau, Mutter oder Autorin. Besonders in kreativen oder selbständigen Berufen sind die Grenzen oft fliessend und die Rollen weniger klar.