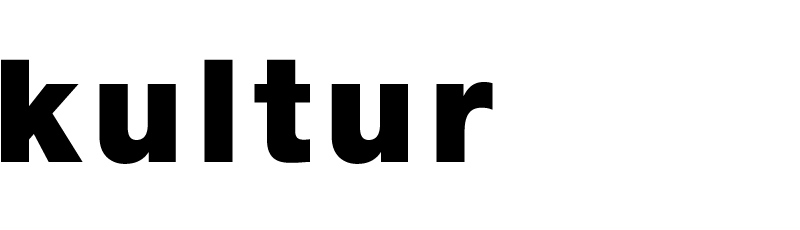Das Bild ist vertraut: Wer im öffentlichen Verkehr zur Arbeit pendelt, sieht in der Regel Mitmenschen leicht gebeugt auf ihren Smartphones herumdrücken, wo sie zum Zeitvertreib durch ihre Social-MediaAccounts scrollen. Wer das nicht tut, gilt als Exot oder als sonstwie bedauernswerte Existenz. Dass Social Media in der Gesellschaft einmal eine derartige Präsenz haben würde, hat womöglich nicht einmal der visionäre Steve Jobs (1955–2011) kommen sehen.
Dabei war der Apple-Vordenker ein Wegbereiter der Social-Media-Revolution, als er 2007 das erste iPhone präsentierte: ein multifunktionales, tragbares und stylisches Tech-Accessoire, das Plattformen wie Facebook, Youtube oder Twitter erst richtig attraktiv machte, weil diese nun immer und überall abrufbar waren.
Entsprechend schnellten weltweit die Nutzerzahlen in die Höhe. Erstaunlich höchstens, dass ausgerechnet Steve Jobs Social Media mied und stattdessen auf analogen Austausch setzte. «Ideen kommen nicht aus E-Mails, Kreativität entsteht in spontanen Meetings und aus zufälligen Gesprächen», war einer seiner Kernsätze.
«Nur so viel des Teufels wie der Mensch selbst»
Heute wäre Jobs in guter Gesellschaft, was das Misstrauen bezüglich der sogenannt sozialen Medien angeht. Gerade im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz warnen Experten vermehrt vor dramatischen gesellschaftlichen Folgen. Sind Social Media also des Teufels? «Nein», sagt Manuel P. Nappo, Studiengangleiter an der Hochschule für Wirtschaft Zürich und Social-Media-Experte.
«Social Media sind nur so viel des Teufels wie der Mensch selbst.» Facebook und Co., erklärt Nappo, würden lediglich verstärken, was ohnehin in der menschlichen Natur vorhanden sei. «Dabei sollte man nicht vergessen, dass Social Media auch Wissen vermitteln oder Interaktionen ermöglichen, die in der realen Welt nicht denkbar sind. Gerade im Kulturbetrieb, wo man stark mit Emotionen arbeitet und dank Social Media eine Beziehung zum Publikum aufbauen kann.»
Wobei Nappo die Gefahren auf dem «globalen Pausenplatz» solcher Netzwerke keineswegs abstreitet. «Eigentlich sind wir alle noch dabei, herauszufinden, wie diese Kommunikationsmittel für die ganze Welt funktionieren. Als User sollte man auch grosszügig zu sich selbst sein. Wir können noch nicht alles verstehen auf diesem ebenso dynamischen wie umkämpften Spielfeld.»
Glaubwürdigkeit ist die Währung von Social Media
Tatsächlich warnte eine internationale Forschergruppe um den US-Biologieprofessor Carl Bergstrom bereits 2021 vor einer globalen Krise, falls Social Media unkontrolliert blieben. Corona habe eine regelrechte «Infodemie» ausgelöst, also eine exponentielle Verbreitung von Fake News, die im schlimmsten Fall zu Extremismus, Hungersnot, Rassismus und Krieg führen könne.
«Das aktuelle ‹Informations-Ökosystem› gibt guter und wichtiger Information überhaupt keine Chance mehr, nach oben zu schwimmen und die Menschen zu erreichen», so Bergstrom. Deshalb sei eine Regulierung zwingend. Doch wie sollte eine solche Regulierung aussehen? Und wer könnte diese durchsetzen? «Eine komplexe Frage», sagt Nappo. «Und zwar deshalb, weil die Grenzen fliessend sind, was an einem Ort noch als normal, andernorts bereits als Provokation gilt.
Wie sollten da ein paar 20-jährige Programmierer im Silicon Valley für die ganze Menschheit entscheiden, was rassistisch oder extremistisch ist?» Auch Nappo weiss jedoch, dass Facebook und Co. nicht untätig bleiben dürfen. «Glaubwürdigkeit ist die Währung von Social Media. Wenn die Nutzer nicht mehr erkennen, ob ein Post wahr ist oder nicht, müssen diese Plattformen zumachen. Dann ist auch das Vertrauen in die Demokratie verloren.»
«Wir sind der kritische Faktor»
Nicht zuletzt deshalb sind immer mehr Social-Media-Angestellte damit beschäftigt, potenziell gefährliches Material zu sichten und entsprechende Accounts zu sperren. Ausserdem hat Twitter erst kürzlich die Zugänge zu seiner Plattform limitiert. Laut Firmenchef Elon Musk «eine vorübergehende Notmassnahme».
«Musk musste das tun, um Computerprogramme daran zu hindern, auf Twitter massenhaft Inhalte abzugreifen, weil sie nur so neue und potenziell falsche Inhalte produzieren können», sagt Nappo. Das Gefährliche sei, dass solche Chatbots mit künstlicher Intelligenz in Sekunden die Arbeit von einem Dutzend menschlicher Fake-News-Autoren übernehmen und verbreiten können – und zwar fehlerlos.
Nicht zuletzt deshalb haben Exponenten wie der israelische Historiker Yuval Noah Harari oder der britische Informatiker Geoffrey Hinton erst kürzlich wieder vor einer Zerstörung der Zivilisation gewarnt. Nappo sagt: «Ich mache mir weniger Sorgen um die künstliche Intelligenz als vielmehr über die menschliche Dummheit. Wenn uns etwas vernichten sollte, dann Letzteres. Wir sind der kritische Faktor.»