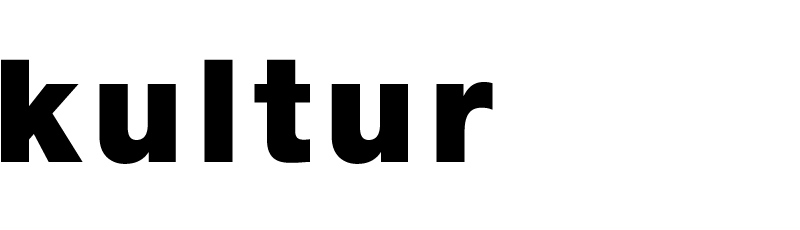In den letzten Wochen sorgte die Berner Reitschule für Schlagzeilen und Diskussionen. Der Drogenhandel auf dem Vorplatz und die damit einhergehende Gewalt eskalierte, was dazu führte, dass Gäste wegblieben und das autonome Kulturzentrum zwei Wochen geschlossen wurde.
Doch nicht nur in Bern, sondern überall in der Schweiz gibt es selbstverwaltete Häuser, einige sind aus Besetzungen oder linken Aufständen entstanden. Etwa das Kuzeb im aargauischen Bremgarten, die Rote Fabrik in Zürich, das St. Galler Rümpeltum oder das AJZ in Biel. In Luzern wird im Zusammenhang mit dem neuen Theaterbau ebenfalls wieder ein autonomes Zentrum gefordert. Solche sind ein ständiges Aushandeln zwischen Idealen und dem Möglichen, Offenheit und Sicherheit. Bei Konflikten versuchen alle, das Herbeiziehen der Polizei zu vermeiden, unter anderem, um Sans Papiers zu schützen, die sich dort aufhalten dürfen. Handelsoptionen gibt es trotzdem.
Ausnüchterungsbett und Streit schlichten
Im St. Galler Rümpeltum etwa gilt: Harte Drogen und harter Alkohol sind unerwünscht. «Erstens putzen wir nicht gern Erbrochenes», erklärt die Betreibergruppe im gemeinsamen Telefoninterview. Zweitens bleibe so die Stimmung friedlicher. «Wenn jemand zu stark ins Glas schaut, legen wir ihn oben ins Bett, und wenn es Streit gibt, versuchen wir, verbal zu schlichten.» Zur Not spreche man Lokalverbote aus, die bisher immer respektiert worden seien.
Das Rümpeltum gibt es seit 22 Jahren. Heute sei es ein wichtiger alternativer Kulturort für die ganze Ostschweiz und ein Anlaufpunkt für Menschen mit wenig Geld, da kein Konsumzwang herrscht. Unbekannte Garagenbands und finanzschwache Zirkustruppen finden hier ebenso eine Bühne wie international erfolgreiche Musikerinnen und Musiker.
Laut dem Team treffen im «Rümpi» verschiedene Subkulturen wie Punks und Hippies oder auch die LGBTQ-Community aufeinander, was zu einem erfrischenden Austausch führe. Sogar SVP-Politiker kämen ab und zu auf ein Bier vorbei. Ob diese willkommen sind oder nicht, darüber ist man sich nicht einig. Aber: «Auch das gehört dazu. Wir diskutieren gern.»
Die Rote Fabrik am Zürcher Seeufer ist aus den Opernhauskrawallen in den 1980er-Jahren hervorgegangen. Heute verfügt das Zentrum über ein etabliertes Restaurant, den Kunst- und Theaterraum Shedhalle und veranstaltet regelmässig Konzerte auf der Hauptbühne. Sandro Berteletti aus dem Vorstand sieht die Fabrik als festen Bestandteil der Zürcher Kulturszene, der wichtigen Freiraum für künstlerische und gesellschaftliche Experimente bietet.
In der langen Geschichte wurde der Ort auch von Externen besetzt wie etwa 2016 von einer Gruppe aus Aktivisten und Geflüchteten. Die Besetzung endete nach einer Woche friedlich dank der Vermittlung durch einen Imam. Generell suche auch die Rote Fabrik bei Regelverstössen den Dialog, so Berteletti. Wenn die Handlung zu schwerwiegend oder keine Besserung in Sicht sei, schliesse man Personen von Veranstaltungen oder Projekten aus. «Ein zentrales Fazit aus den über vier Jahrzehnten Selbstverwaltung sind klare Kommunikation und transparente Entscheidungsprozesse», sagt Berteletti.
«Wir sind ein wichtiger Stachel im System»
Seit Ende Januar ist auch die Berner Reitschule wieder geöffnet. Lou vom Kollektiv erzählt: «Wir haben während der Schliessung einen tiefgründigen Prozess gestartet, in dem wir uns gefragt haben, wo unsere Verantwortungen liegen und wo wir Unterstützung brauchen.» Zunächst wolle man den Vorplatz beleben, dort präsenter sein und die Zuschauerinnen und Zuschauer zur Verantwortungsübernahme ermuntern. Auch ein runder Tisch mit Politik und Polizei ist geplant. Lou hat Hoffnung, dass die Reitschule ihre momentane Krise überwinden kann.
«Grundsätzlich können wir unserem Publikum Sicherheit bieten, auch bei Grossveranstaltungen mit bis zu 2000 Gästen.» Ein grosser Erfolg sei beispielsweise das kostenlose «No Borders, No Nations»-Festival, bei dem letztes Jahr Pop-Grössen wie Nemo aufgetreten sind. Generell sei die Reitschule ein Ort, der aufzeige, dass ein weniger kommerzielles Kulturmodell möglich ist. «Deshalb sind wir ein wichtiger Stachel im System», sagt Lou.
Partizipatives oder autoritäres Regelbuch?
Olivier Moeschler ist Kultursoziologe an der Uni Lausanne. Er beschreibt eine Rollenänderung autonomer Zentren seit den 1980ern bis heute. «Globalisierung und kulturelle Toleranz sind heute weit verbreitet. Die Kehrseite ist, dass die Zentren jetzt nur noch Schlagzeilen machen, wenn sie ordnungspolitisch auffallen – was aber soziologisch auch ein Teil ihrer systemkritischen Funktion ist.»
Für ihn seien solche Orte auch deshalb interessant, weil sie illustrierten, dass soziales Leben – egal welcher politischen Ausrichtung – ohne Konventionen und Sanktionen nicht möglich sei. «Die entscheidende Frage ist aber, ob diese Regeln partizipativ oder autoritär definiert werden.»
Olivier Moeschler sieht autonome Kulturzentren als «Laboratorien einer engagierteren Demokratie und als solche essenziell, auch in ihren Widersprüchen.» Aktuell sei das besonders wichtig. «Weil autoritäre Machtvorstellungen ein besorgniserregendes Revival erleben.»
Kulturtipps
Tojo Theater (Reitschule) Bern
Theater
Spacehands: «Spaceship»
Sa, 15.2., 20.30 und
So, 16.2., 19.00
Clubraum Rote Fabrik Zürich
Vortrag
Henrik Nordborg zur Klimakrise: Stehen wir am Abgrund oder sind wir schon einen Schritt weiter?
Do, 20.2., 19.30
Kuzeb Bremgarten AG
Film
Dok am Dunschtig: Filme zur Geschichte des Kuzeb
Do, 20.2., 20.00
Rümpeltum St. Gallen
Konzert
Duke Garwood: Experimental Blues Songwriter aus England
Fr, 28.2., 19.15
AJZ Biel
Konzert und Party
Holly G (Afro-Trap, Shatta)
Sa, 1.3., 22.00