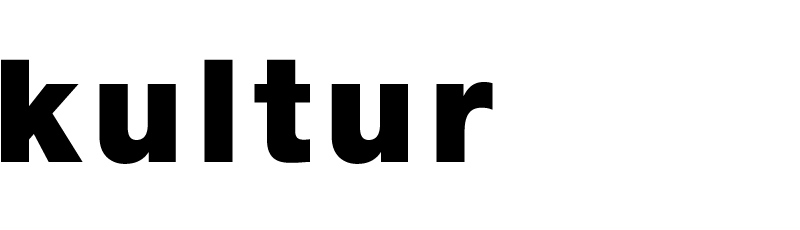Etwas verunsichert steht man am Eingang zur Ausstellung im Berner Generationenhaus: «Hilfe, ich erbe!», ist sie betitelt. Und auch der Ausstellungsmacher Michael Fässler nimmt einem die Ängste nicht: «Hier kommen zwei grosse Tabus zusammen: das Geld und der Tod.» In der Schweiz wurden im letzten Jahr schätzungsweise 100 Milliarden Franken vererbt.
Das ist doppelt so viel, wie die AHV jährlich auszahlt. Zwei Drittel der Erbschaften gehen an die wohlhabendsten zehn Prozent. Die Verteilung ist ungleich, für gesellschaftspolitische Brisanz ist damit gesorgt. Die Schau geht trotz überschaubaren Räumlichkeiten weit über die ökonomischen Aspekte hinaus. «Was macht das Erbe mit uns? Was machen wir mit unserem Erbe?», fragt sie.
Menschen erzählen von ihrem Erbe
Gleich zu Beginn zeigt sich die Vielfalt des Erbens. An einer blauen Wand kleben Wörter auf weissen Filzstücken: «Musikalität», «Privilegien», «Ferienwohnung». Die für einen passenden Begriffe können so auf eine Weste geklebt werden, die am Anfang des Rundgangs geholt werden kann. Auf der Rückseite der Worttäfeli lernt man, dass Gesichtsausdrücke oder Taktgefühl nicht nur erlernt, sondern auch vererbt sind. Klebt man sich nun nur jenes Erbe an, auf das man stolz ist, oder auch jenes, das man lieber nicht mit sich rumtragen würde?
Der nächste Raum selbst wird durch seine verspiegelte Rückwand zum optischen Erlebnis. Er ist ein äusserst beliebtes Fotomotiv und hat dadurch sozusagen sein Erbe als Denkmal bereits jetzt angetreten. Weiter geht es zu grossen Bildschirmen.
Sieben Menschen erzählen in Videoporträts, was sie geerbt haben: Michèle das Judentum und damit eine schwere kollektive Geschichte. Valérie lebt mit einer vererbten Genmutation und hat sich präventiv ihre Brüste amputieren lassen. Philippe wollte das Familienunternehmen nicht weiterführen. Und Sarah weiss nicht genau, was von ihrer Familie in ihr lebt. Sie ist adoptiert.
Spiegelschränke halten Antworten bereit
Immer wieder kommen Fachpersonen über Kopfhörer zu Wort. Zum Beispiel die Psychologin und Podcasterin Felizitas Ambauen. Es gebe bestimmte Situationen im Leben, in denen einen das persönliche Erbe plötzlich stärker beschäftige, sagt sie. Etwa wenn eigene Kinder geboren und damit drängende Fragen zutage treten würden.
Auch eigene Verhaltensmuster würden viele ins Grübeln bringen. Wie gefangen sind wir also in dem, was uns weitergegeben wird? An einer Wand hängende Spiegelschränke halten Antworten bereit. In diesen erfährt man, dass Gene und Umwelt in einer komplexen Wechselbeziehung stehen. Das Muskelwachstum etwa ist, obwohl teilweise vererbt, beeinflussbar.
Die Molekularbiologin Jo Zayner griff zwecks Selbstoptimierung zu drastischeren Methoden als Sport. Die Biohackerin injizierte sich 2017 als erster Mensch eine selbst entwickelte genetische Modifikation, wie man auf einer Porträttafel erfährt. Nebenan blickt man in das gezeichnete Gesicht von Kim de l’Horizon – de l’Horizons «Blutbuch» dreht sich nicht nur um Geschlecht und Identität, sondern auch um Klassenzugehörigkeit.
Und so drückt das Geld, obwohl es im Berner Generationenhaus nur einer unter vielen Erbaspekten ist, immer wieder durch. Eindrücklich ist die «Geburtenlotterie». Das Glücksspielrad veranschaulicht die Willkür, mit der Wohlstand und Erbe verteilt werden. Man dreht daran und kann guten sozioökonomischen Status oder gute Bildung gewinnen – oder das Gegenteil.
Es sind Startchancen oder Hürden in die man «reinkatapultiert» wird, sagt Michael Fässler, deterministische Konstanten eines Erbes. Und das in einer «Multioptionsgesellschaft», in der gern gesagt werde, dass alles möglich sei. Die Ausstellung spielt mit diesem Spannungsfeld. Gleichzeitig, so Fässler, wolle man erbtechnischen Handlungsspielraum aufzeigen. Wie man sein Erbe regeln kann, erklären Expertinnen und Experten über Kopfhörer.
Sie sind Teil des Beratungsteams des «Beobachters», mit dem das Berner Generationenhaus eine Partnerschaft
eingegangen ist. In der begleitenden Zeitschrift erklären Fachpersonen, wie die ungleiche Verteilung von Erbe und damit Vermögen dazu führen, dass Bürgerinnen und Bürger daran zu zweifeln beginnen, dass sich Leistung überhaupt noch lohnt. Die Zweifel würden so weit reichen, dass sie das Vertrauen in Institutionen erschüttern und den Weg für Verschwörungstheorien und rechtspopulistisches Gedankengut ebnen können.
Mit Pingpongbällen Massnahmen bestimmen
Was also soll die Gesellschaft gegen das Ungleichgewicht tun? Mit Pingpongbällen können Besucherinnen und Besucher verschiedene Massnahmen bestimmen. Die Säule mit «Multimillionäre besteuern und Klima retten» hat bisher am meisten Bälle erhalten.
Am Ende von viel Aufwühlendem hätte man sich im Raum mit der Videoinstallation einen entspannenden Ausklang ersehnt. Doch die märchenhafte Stimme bringt einen auf Gedanken, denen man sich in diesem meditativen Setting nur aussetzen sollte, wenn man die Musse hat. Man horcht nochmals tief in die eigenen familiären Konstellationen hinein. Leicht unheimlich.
Auch sonst gibt es wenige Dinge, die nicht ganz durchdacht wirken. Gene erklärt man allenfalls besser mittels Grafiken anstatt Text, juristische Sachverhalte hätte man als Miniratgeber anstatt Audiostationen aufbereiten können – gerne mit mehr Sitzmöglichkeiten und weicherem Ton.
Im Gästebuch aber gibts nur Dankbarkeit. «Hat mich nachdenklich gemacht», liest man am häufigsten. Der Ausruf «Hilfe, ich erbe!» wird damit zwar nicht entkräftet, die Motivation, sich konstruktiv mit dem Thema Erben auseinanderzusetzen aber ist angeregt. Sei es aus Gestaltungswillen oder auch einfach aus Angst.
Hilfe, ich erbe! – Was uns prägt und bewegt
Bis So, 26.10.
Generationenhaus Bern