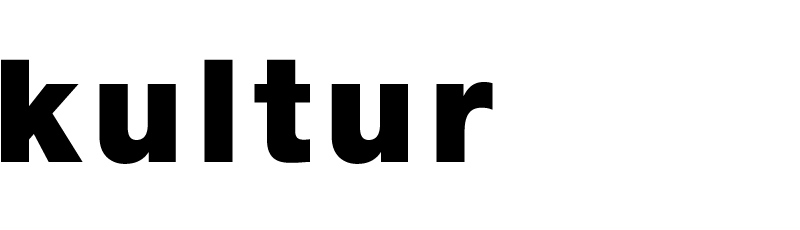Als ich zum ersten Mal an einer Poetry Night war, hatte ich Gänsehaut. Eine Situation wie diese hatte ich noch nie erlebt: Es war Samstagabend, wir sassen im Wohnzimmer der Gastgeberinnen in Brooklyn, das etwas geräumiger als üblich war und das sich direkt mit der kleinen Küchenzeile verband. Auf der Anrichte und dem wackligen Campingtisch standen unzählige Rotweinflaschen. Das Motto des Abends lautete «Wine & Poetry», und von jeder Besucherin und jedem Besucher wurde eine Flasche Wein erwartet. Alle möglichen Sitzgelegenheiten im Raum waren in Beschlag genommen worden. Wir sassen auf dem Sofa, seinen Armlehnen, den Sesseln, den Hockern und den Klappstühlen, wir lehnten halb stehend an der Fensterbank und hatten uns auf dem Boden verteilt, sodass man aufpassen musste, wohin man seinen Fuss setzte, wenn man sich den Weg nach vorne bahnte, um in den leeren Kreis vor dem Kamin zu treten, um vorzulesen.
Der Auftritt der Poetinnen und Poeten lief immer ähnlich ab. Die Person stieg in den Kreis, schaute sich kurz um und schickte ein paar einleitende Worte voraus. Die meisten machten einen Scherz, um die Anspannung ein wenig zu lösen, wir – das Publikum – lachten ein wenig freigiebiger als nötig. Den meisten stand schliesslich an diesem Abend die Prozedur auch noch bevor, und die Stimmung war aufgeregt und unterstützend. Dann hob die Person ihr Telefon, das bisher in einer der beiden Hände beim Gestikulieren störte, und verfiel in einen kurzen Moment der Stille, der sich im ganzen Raum und über das zusammengepferchte Publikum ausbreitete. Unsere Blicke ruhten auf der Person in der Mitte, oder auf dem Dielenboden, oder auf unseren Händen, oder auf dem Glas Rotwein darin – aber eigentlich starrten wir alle ins Leere und warteten in einer kurzen, meditativen Stille. Dann nahm sie einen tiefen Atemzug und begann zu lesen.
Ich war jedes Mal gefesselt. Im Nachhinein betrachtet, hatte das sicher auch mit dem vielen Rotwein zu tun, doch in der Situation selbst kam mir alles sehr feierlich vor. Die schummrige Beleuchtung, die vielen Menschen, die gebannt lauschten und die sich von den Worten dieser einen Person tragen liessen, die im Widerschein ihres Telefons fast unmerklich von einem Bein auf das andere trat und die Zeilen teilte, die sie zu Poesie erkoren hatte. Die Selbstverständlichkeit des ganzen Abends war faszinierend. Vor allem, wenn man aus einem Umfeld kommt, in dem selbst professionelle Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit Understatement glänzen. An diesem Abend waren alle «Poets» und nicht verlegen, ihre Ergüsse zu teilen.
Vor einigen Tagen fand ich mich erneut auf einem Poetry Event wieder, und es war so ziemlich das Gegenteil des Weinabends in Brooklyn. Jeden letzten Montag des Monats lädt das Zürcher Label Silbenschmied zum «Poetry Slam», bei dem sich Neulinge mit etablierten Grössen der Szene auf der kleinen Bühne der «Eldorado»-Bar am Limmatplatz messen. Auf der Website heisst es, Zürich sei eine der bekanntesten Poetry-Slam-Städte Europas, da sie Austragungsort von bereits zwei deutschsprachigen Meisterschaften und zahlreichen Festivals war. Mir war all das vollkommen neu.
Doch tatsächlich war die Bar an diesem Abend voll. Nacheinander traten insgesamt neun Slammerinnen und Slammer in das warme Scheinwerferlicht, ergriffen das Mikrofon und brachten das Publikum zum Lachen. Keine Gänsehaut, keine Unmengen Rotwein, doch der entscheidendste Unterschied lag in dem, was wir zu hören bekamen: gute Texte. Die Poetry Slammer des Abends waren stilistisch sehr unterschiedlich und bewegten sich teils im Bereich Kabarett oder Stand-Up-Comedy, teils in eher klassisch lyrischen Gefilden, doch ihre Arbeiten waren geprägt von einer durchdachten Struktur, wohlgewählten Worten und einer konkreten Geschichte, die sie erzählten. Und niemand las vom Handy ab.
Damals in Brooklyn war es mir nicht bewusst, aber mit dem Vergleich vor Augen, fiel mir auf, dass die dort vorgetragenen Texte vor allem Feststellungen von völlig banalen Ereignissen waren. Solche Dinge, denen man ironisch applaudieren und antworten möchte: Schön für dich, aber warum genau erzählst du das?
Die Sharing-Kultur der digitalen Welt hat den Weg geebnet für eine schier unendliche Menge an sinnlosem Content, der von privaten und öffentlichen Personen, Blogs und Websites die Server dieser Welt füllt. Etablierte Medienunternehmen haben sich diesem Trend angepasst, und die Mechanismen von Social Media adaptiert, in denen Klicks, Likes und Shares ein wichtiges Kriterium für Erfolg sind.
Nun will ich nicht behaupten, dass all die Erfahrungen, die an diesem Abend in Brooklyn ihren Weg in unsere Halböffentlichkeit fanden, sinnlose Inhalte waren. Im Gegenteil, die Fähigkeit zur Selbstreflexion und Einordnung ist eine wichtige Voraussetzung für inneres Wachstum. Was der «Wine & Poetry Night» jedoch fehlte, war das Weiterdenken nach dem bedingungslosen Offenlegen von Gefühlen und Erlebnissen. Im reinen Akt der Präsentation war der poetische Akt bereits vollzogen. Ein Erlebnisbericht unterschiedlichster Situationen wurde zur Poesie gekürt. Es wurde nicht einmal weiter über die Beiträge der Einzelnen gesprochen, niemand tauschte sich wirklich aus. Man wartete nur andächtig auf den eigenen Soul-Strip-Moment. Am Ende war der Abend ein rotweintrunkener Exhibitionismus einzelner Traumata. Wann ist aus der Sharing-Kultur eine Kultur des Oversharings geworden?
Emotionale Offenbarungen sind an sich nichts Schlechtes – aber sie passen eher in eine Gruppentherapie als an eine «Poetry Night». Poesie kann inzwischen sehr frei und formlos daherkommen und allerlei spannende Formen annehmen, doch sie lebt vom kunstvollen Verdichten von Gefühlen und Gedanken, die beim Publikum etwas auslösen. Inhalt, Form und Darbietung greifen bestenfalls ineinander und lassen etwas Magisches entstehen. Manchmal verwechselt man das mit dem teilnahmsvollen Zuhören und dem Schwelgen in Selbstbezug. Der Slam-Abend in Zürich erinnerte mich daran, dass Poesie mehr sein kann: eine bewusste, literarische Form, die über blosse Intimität hinausgeht.
Zur Person
Ann Mbuti (* 1990) ist Professorin für Prozessgestaltung an der Hochschule für Gestaltung HGK Basel und unabhängige Autorin. Neben dem Schreiben ist sie auch als Kuratorin tätig, macht Vorträge, Moderationen und Workshops und führt Forschungsprojekte durch. 2022 ist ihr Buch «Black Artists Now» im Verlag C. H. Beck erschienen. Ihre Projekte und Publikationen behandeln Themen wie zeitgenössische Mythologien, Science-Fiction und die Verschmelzung von Fakten und Fiktion. Ann Mbuti lebt und arbeitet in Zürich.